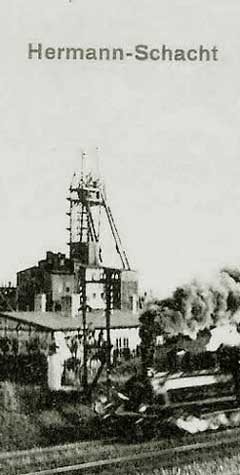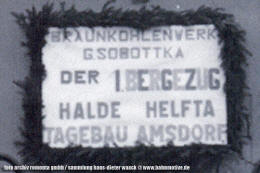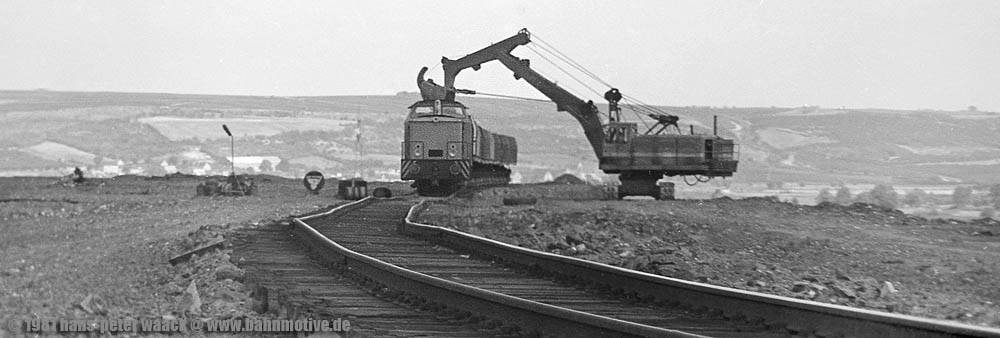| |
aufmerksam zu machen. Die Gleise wurden -
so wie die Ladestelle gewandert ist - auf der Halde mehrfach verrückt,
was relativ problemlos ging, denn man hat die Joche nicht geschottert. Den Zug nannte man
Schlackependel, was nicht ganz exakt war, denn es wurde ja taubes
Gestein verladen und keine Schlacke. Ganz offiziell hieß der Zug
"Bergezug". Wenn die Kohlekumpel den Begriff aber einmal erfunden haben,
dann bleibt der.
Zwischen der Halde und dem Höhenzug im Hintergrund
liegt noch der dort ca. 600 m breite Süße
See. Die Mansfelder Seen -
auch als die zwei blauen Augen des Mansfelder Landes bezeichnet - und
die Halden prägten einst die Gegend ganz entscheidend, nicht nur wegen
der damit verbundenen markanten landschaftlichen Eindrücke. Der Salzige
See ist schon seit 117 Jahren weg und die Halden sind bis auf wenige
Ausnahmen auch abgetragen. Wassermäßig ist die Gegend mit einem blauen
Auge davon gekommen, sagt man. Wann die Wunden aus dem Niedergang des Bergbaues
für die Leute hier
verheilen, lässt sich überhaupt nicht abschätzen. Zurück zum Zug. Die Wagen hatten normalerweise für den
Grubenbetrieb eine Mittelpufferkupplung mit einem festen Kuppeleisen.
|
|